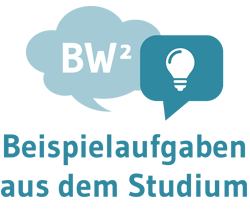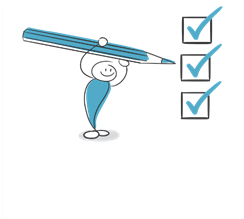Medien, Menschen, Daten und Informationen – darum geht es im Bachelorstudiengang Informationswissenschaften. Die digitale Informationsflut steigt. Doch wie trennen wir die gesicherten Informationen von den falschen? Und wie schaffen wir für alle Menschen Chancengleichheit beim Zugang zu gesichertem Wissen? Was ist der richtige Umgang mit Informationstechnologie und Medien? Gleichzeitig erfassen Unternehmen unsere Daten und ermöglichen nie dagewesene Anwendungen. Wie gestalten wir dabei Datenschutz und Privatsphäre? Unsere Absolvent*innen nehmen diese Herausforderungen an.
Schauen Sie sich das Video an, um einen ersten Eindruck vom Studiengang zu bekommen.
Film zum Studiengang Informationswissenschaften
Copyright: Hochschule der Medien
Das Studium gliedert sich in vier Phasen. Basiswissen und Kernkompetenzen werden in den ersten zwei Semestern vermittelt. Ab dem 3. Semester erfolgt die Wahl zwischen zwei Schwerpunkten: Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement und Daten- und Informationsmanagement. So ist es möglich, ein individuelles Profil auszubilden und in einem sehr breiten und dynamischen Berufsfeld den eigenen Weg zu finden.
Im Schwerpunkt Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement sind Sie richtig, wenn Sie
- kreativ, innovativ und kulturell interessiert sind,
- bereit sind, Führungsverantwortung zu übernehmen,
- engagiert, neugierig und kundenorientiert sind und gerne mit Menschen umgehen,
- Spaß daran haben, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und sich immer wieder auf Neues einzustellen.
Im Schwerpunkt Daten- und Informationsmanagement sind Sie richtig, wenn Sie
- Interesse an Daten und Informationstechnik haben,
- gerne strukturiert und systematisch denken,
- kreativ, innovativ und gesellschaftlich interessiert sind,
- Spaß daran haben, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und sich immer wieder auf Neues einzustellen.
Das 5. Semester des Bachelorstudiums ist ein praktisches Studiensemester. Im 6. und 7. Semester studieren Sie ausschließlich projektorientiert. Ein Beispiel für ein solches Projekt ist bibTalk: Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen planen, organisieren und moderieren gemeinsam eine Fachkonferenz. Die Studierenden erarbeiten aktuelle Themen der Fachdiskussion und präsentieren diese dem Fachpublikum in innovativen Veranstaltungsformaten. Im Jahr 2019 war das Thema beispielsweise: Zukunft – Nachhaltig – Gestalten.
Überblick zum Bachelorstudiengang Informationswissenschaften an der Hochschule der Medien Stuttgart
|
Studiengang |
Besonderheiten |
Abschluss |
Regelstudienzeit |
|
Informationswissenschaften |
|
B.A. |
7 Semester |
|
Informationswissenschaften (Short-Track) |
|
B.A. |
5 Semester |
Auf der Seite der Hochschule der Medien Stuttgart finden Sie die aktuellen formalen Studieneingangsvoraussetzungen und die aktuellen Informationen zur Studienverlaufsplanung.
„In Bibliotheken stehen Bücher und Zeitschriften.“
Es ist zwar richtig, dass Bibliotheken Bücher, Zeitungen und Zeitschriften für ihre Kund*innen anbieten. Schließlich setzt sich das Wort „Bibliothek“ aus „biblion“ („Buch“) und „theke“, was so viel heißt wie „Behältnis, Speicher“, zusammen. Heute bieten Bibliotheken allerdings weit mehr: eBooks, eJournals, Datenbanken, Brett- oder Konsolenspiele gehören zum Standardangebot von Bibliotheken. Bibliotheken sind aber nicht nur Speicher für Medien, sondern vielgenutzte Lern- und Kulturorte. Einige bieten auch Makerspaces oder Repair Cafés an. Es gibt keine anderen öffentlichen Kultur- oder Bildungseinrichtungen, die von so vielen Menschen genutzt werden, wie Bibliotheken. Über 200 Millionen Besuche sind es in Deutschland jedes Jahr. Im Vergleich: Ins Kino gehen 146 Millionen und die 1. und 2. Bundesliga hat zusammen 18 Millionen Zuschauer*innen.
Bibliotheken arbeiten kundenorientiert. Deshalb bieten sie genau das an, was ihre jeweiligen Kund*innen benötigen. Wissenschaftliche Bibliotheken stellen ihr Angebot vorrangig nach den Bedürfnissen von Forschung, Studium und Lehre zusammen. Sie haben vor allem Studierende und Forscher*innen im Blick. Wissenschaftliche Bibliotheken sind bspw. National-, Landes-, Universitäts- und Hochschulbibliotheken. Stadtbibliotheken (in der Fachsprache spricht man oft von „Öffentlichen Bibliotheken“) sind Kommunikations-, Informations- und Kulturzentren in einer Stadt. Das heißt, ihre Aufgabe besteht neben der Informationsversorgung auch darin, die kulturelle Bildung und das demokratische Verständnis zu fördern. Oft sind sie die einzigen Orte in einer Stadt, an denen man sich völlig ohne Konsumzwang treffen, neue Leute kennenlernen und sich austauschen kann. Darüber hinaus gibt es Informationseinrichtungen in Unternehmen, Forschungsinstituten, Medienanstalten, Museen oder großen Behörden. Ihre Aufgabe ist es, für die Mitarbeitenden dieser Institutionen Informationen passgenau zu recherchieren, aufzuarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
„Bibliotheken sind in einer digitalisierten Welt überflüssig, weil man sich alles aus dem Internet runterladen kann.“
Das stimmt nicht, denn viele und vor allem wertvolle, qualitätsgeprüfte Informationen sind hinter sogenannten „Paywalls“ verborgen. Das heißt, man muss für den Zugang bezahlen. Bibliotheken lizenzieren solche Informationsquellen, sie bezahlen also für Abonnements oder Datenbanken. Nur so können die Kund*innen der Bibliothek sie nutzen.
Die Aussage stimmt aber auch deshalb nicht, weil Bibliotheken heute viel mehr sind als Buchlager, aus denen man etwas ausleiht. Sich treffen, im Makerspaces gemeinsam etwas bauen, gemeinsam lernen und diskutieren, gemeinsam Kaffee trinken und an einer Veranstaltung teilnehmen: Dazu braucht es reale Orte. Bibliotheken sind solche Orte.
Man kann auch sagen, dass Bibliotheken und Informationseinrichtungen den gesellschaftlichen Auftrag haben, Bürger*innen den freien Zugang zu Wissen und Kultur zu ermöglichen. Informationseinrichtungen verstehen es als ihre Pflicht, Informationsfreiheit für eine aufgeklärte Gesellschaft zu gewährleisten.
„Wenn ich nichts mit Computern zu tun haben möchte, dann bin ich in einer Bibliothek, Informations- oder Kultureinrichtung genau richtig.“
Das Gegenteil ist der Fall. Ohne Computer geht in Bibliotheken und Informationseinrichtungen heute gar nichts mehr. Das fängt damit an, dass in vielen Bibliotheken die Kund*innen die Medien über IT-gesteuerte Selbstbedienungsterminals verbuchen und dass Rückgabeautomaten und Sortieranlagen es ermöglichen, auch nachts und am Wochenende Medien in die Bibliotheken zurückzubringen. Online-Kataloge und Websites dienen dazu, das, was eine Informationseinrichtung anbietet, z.B. auch Computerspiele oder eBooks, recherchierbar zu machen. Der Umgang mit Social Media gehört ebenfalls zum Alltag, denn viele Bibliotheken sind auf diesen Kanälen präsent.
Bibliotheken sind aber auch verantwortlich dafür, das kulturelle Erbe zu bewahren. Das heißt, sie digitalisieren wertvolle alte Bücher, Handschriften, Karten, Fotos, Filme oder andere Objekte und sorgen durch die sogenannte Langzeitarchivierung dafür, dass diese Schätze auch in Zukunft erhalten bleiben und oft online weltweit genutzt werden können. Bibliotheken entwickeln außerem Strategien, um nicht nur die Objekte, sondern auch Daten zu managen. Aus diesem Grund erlernen Studierende der Informationswissenschaften die Grundlagen der Informatik: Sie sind dann in der Lage, Informationen aufzuarbeiten, zu systematisieren und zur Verfügung zu stellen. Sie setzen sich aber auch mit den Anwendungsmöglichkeiten von Virtual Reality und Künstlicher Intelligenz auseinander.
„Wenn ich nichts mit Menschen zu tun haben möchte, dann bin ich in einer Bibliothek, Informations- oder Kultureinrichtung genau richtig.“
Das Gegenteil ist der Fall. In Bibliotheken geht es nicht mehr zuerst um Medien, sondern es geht zu allererst um Menschen. Bibliotheken sind Treffpunkte, Lernorte, Orte der öffentlichen Diskussion. Sie sind einer der wenigen Orte, an denen man sich aufhalten kann, ohne dafür bezahlen oder etwas konsumieren zu müssen. Deshalb kommen täglich sehr viele Menschen in Bibliotheken. Das ist lebendig und abwechslungsreich, es geht aber nicht immer ohne Konflikte. Hier sind dann Informationswissenschaftler*innen als kommunikationsstarke „Community-Manager*innen“ gefragt. Sie bieten zudem für ganz unterschiedliche Zielgruppen Schulungen an, z.B. zur Recherche nach Informationen, zur Erstellung einer Hausarbeit oder eines Referats oder zum Umgang mit elektronischen Medien. Sie beraten bei der Medienauswahl und sie organisieren ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm: Lesungen, Konzerte, Workshops, Kino und Ausstellungen.
|
Aufgabenbereiche für Absolvent*innen mit dem Schwerpunkt |
Aufgabenbereiche für Absolvent*innen mit dem Schwerpunkt Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement |
|
|
|
Typische Arbeitgeber für Absolvent*innen |
Typische Arbeitgeber für Absolvent*innen mit dem Schwerpunkt Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement |
|
|